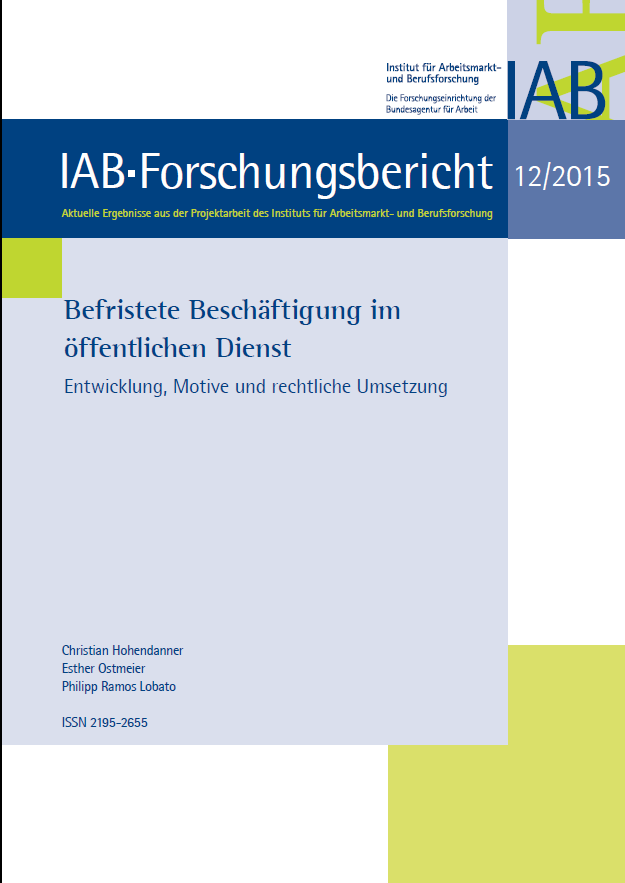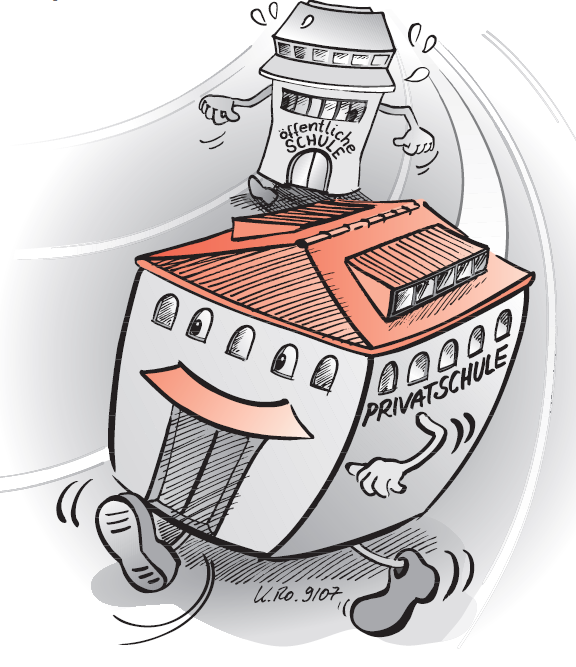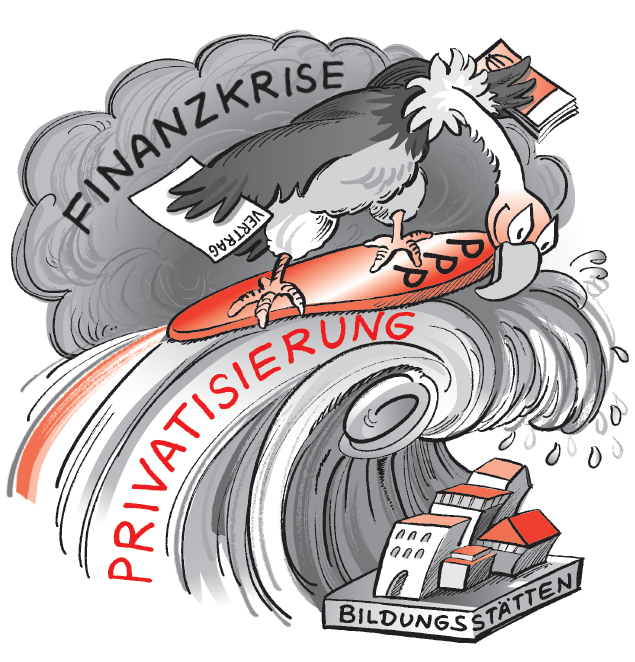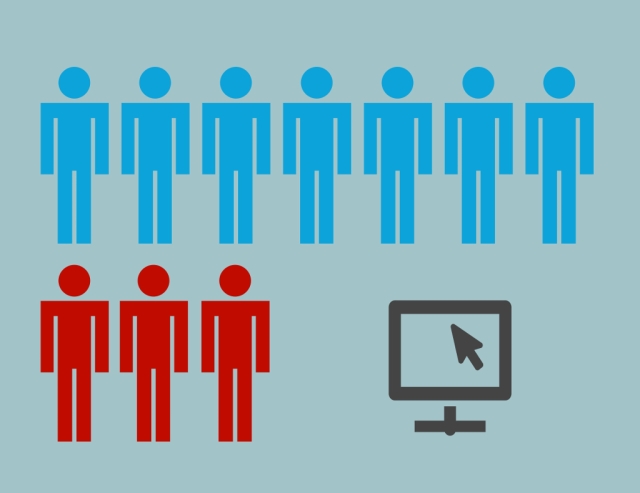Die Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zu Befristungen im öffentlichen Dienst weist auf Handlungsbedarfe hin.
Bildungspolitik
Die Hochschulen befinden sich seit der Jahrhundertwende im Wandel. Reformprojekte, die die Kommerzialisierung von Bildung, die Privatisierung der Hochschul- und Studienfinanzierung (Verbot eines bundesweit einheitlichen Studiengebühren-Verbots 2005) oder die Umstellung auf eine gestufte Studienstruktur (Bologna-Prozess seit 1999) zum Ziel haben, waren vor fünfzehn Jahren noch in Planung, heute sind sie in großem Umfang umgesetzt. Gleiches gilt für Projekte der Entstaatlichung und Deregulierung (Föderalismusreform 2006, Abschaffung des Hochschulrahmengesetzes).
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Weder dämonisiert noch bekämpft die GEW private Bildungseinrichtungen. Sie stellt auch nicht die mitunter sehr gute pädagogische Qualität der dort geleisteten Arbeit in Frage. Schulen in privater oder „freier“ Trägerschaft – zum Beispiel kirchlich getragene Schulen, reformpädaogisch orientierte Schulen oder auch Internate – gab es schon immer, die Schullandschaft konnte ganz gut damit leben.
Private Bildungseinrichtungen gab es in Deutschland schon immer. Nicht selten auch gegründet und betrieben, um Defizite im öffentlichen Bildungswesen zu vermeiden und Reformalternativen zu praktizieren. Dazu kamen konfessionelle Einrichtungen mit ihren spezifischen Ansätzen. Hierbei entwickelten sich einige – vor allem pädagogisch – sinnvolle Alternativen, zumal die Arbeits- und Vergütungsbedingungen der Beschäftigten durchaus mit denen des öffentlichen Bildungswesens vergleichbar waren und nicht Gewinnerzielung der Grundzweck war.
Am Samstag, den 13.2.16 bot die AG Jugendliteratur und -medien der GEW Hamburg eine Tagung zur Weiterbildung an, die die Bewertung von Kinder- und Jugendliteratur durch Rezensenten zum Thema hatte und den Möglichkeiten nachging, wie Schülerinnen und Schüler im Deutschunterricht ihr Urteil über ein Buch von der rein inhaltlichen Bewertung zu einer mehr formal-ästhetischen weiterentwickeln und sich ihrer eigenen Kriterien bewusst werden können.
Das Studium der Sonderpädagogik an der Universität Hamburg steht derzeit vor großen Problemen. Am 10.02.2016 wurde in einer Fakultätsratssitzung der Erziehungswissenschaft über das Aussetzen der Förderschwerpunkte „Lernen“ und „Körperliche & Motorische Entwicklung“ im Masterstudiengang „Lehramt für Sonderpädagogik“ ab dem Wintersemester 2016/17 diskutiert. Diese Entscheidung wurde durch die Bemühungen des Fachschaftsrates der Sonderpädagogik auf den kommenden April vertagt.
Die Integration von Geflüchteten im Bildungsbereich wird Schätzungen zufolge aktuell 4,2 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Insgesamt macht der Bildungsforscher Roman Jaich einen jährlichen Mehrbedarf von etwa 55 Milliarden aus.
Rund drei Viertel der Schulabbrecher bekommen keinen Ausbildungsplatz. Um Jugendliche erfolgreich zum Abschluss zu lotsen, spielt auch Schulsozialarbeit eine Rolle. Dort, wo sie eingesetzt wird, hilft sie, die Abbrecherquote zu verringern.
Seit 2004 gibt es Studiengänge für Kindheitspädagogik. Die Tarifverträge für die Kita-Beschäftigten bilden diese Entwicklung jedoch (noch) nicht ab. Die Mehrheit der Kindheitspädagoginnen und ‑pädagogen wird nicht entsprechend ihrer akademischen Qualifikation bezahlt.
Open Educational Resources (OER), freie Bildungsmaterialien aus dem Netz, sind schlecht auffindbar und kaum verbreitet. Wikimedia will dies ändern und wird am 28. Februar konkrete Handlungsempfehlungen vorlegen.
Das Institut Sonderpädagogik der Universität Hamburg steht unter Kürzungsdruck. Am Mittwoch, den 10.02.2016, wird in einer Fakultätsratssitzung der Erziehungswissenschaft über das unbefristete Aussetzen der Förderschwerpunkte „Lernen“ und „Körperliche & Motorische Entwicklung“ im Master ab dem kommenden Wintersemester 2016/17 abgestimmt.
Lehrkräfte für Deutsch als Zweit- (DaZ) und Deutsch als Fremdsprache (DaF) sind bundesweit gefragt wie nie. Bei ihrer Eingruppierung herrscht indes oft Unsicherheit - zu Lasten der Lehrenden, die vermehrt SeiteneinsteigerInnen sind.